
Die wiederholten Attacken auf das Hamburger „Jellyfish“ und die Aufgabe des Restaurants haben für viele Leute etwas Desillusionierendes. „Gute Küche mitten in der Szene“ – das ist doch was und der Wunschtraum vieler jüngerer und kreativer Köche. Aber – macht man sich da nicht etwas vor? Sollen da zwei Dinge zusammenkommen, die nicht zusammenpassen? Die Geschichte dazu hat im Grunde schon vor einer ganzen Reihe von Jahren begonnen.
Robuchon 2003
Im Jahr 2003 eröffnete Joel Robuchon in Paris sein erstes „Atelier“ und erregte damit weltweit Aufsehen. Da machte ein Weltstar der Küche ein Restaurant auf, in dem man an der Bar saß, Tapas-Portionen bekam und – das war der ganz große optische Gag – alle Köche schwarze Kleidung trugen. Von heute aus gesehen, scheint das unwichtig. Damals war das revolutionär, weil es dem Ganzen eine komplett andere Ästhetik gab – moderner, neuartig, lockerer, künstlerischer, mitten drin im Leben, mitten drin in einer Modemetropole. Wohlgemerkt: Berichte aus dem Restaurant von Michel Bras in Laguiole kamen damals nicht ohne die Bemerkung aus, dass es in dieser so naturnahen Küche aussah wie in einem Labor. Alle Köche trugen nicht nur weiße Jacken, sondern auch weiße Hosen, und beugten sich über ihre Kräutersammlungen mit Pinzetten wie die Ärzte bei einer Operation. Robuchon hat in einem seiner letzten Interviews noch einmal darauf hingewiesen, dass er die Optik der Kochwelt entscheidend verändert hat. Dass andererseits die Sache zumindest in Frankreich nicht ganz durchgegriffen hat, konnte man vor wenigen Tagen noch in der französischen Ausgabe von „Top Chef“ sehen. Alain Ducasse trat dort wieder wie immer in weißer Montur inklusive langer weißer Schürze auf.
Rock‚n’Roll in der Küche
Die Auflockerung der Küche – oder genauer: die Auflockerung der Küchenbrigaden – nahm ihren Lauf. Aus der starr funktionalen Optik des Küchenprofis wurde im Laufe der Jahre ein immer mehr nach „Szene“ aussehendes Image, das heute weitgehend deckungsgleich mit aktuellen Moden ist. Bart und Tätowierungen, gerne laute Musik bei der Arbeit, eine Affinität zu Disco und House usw. (etwa: Nick Bril von „The Jane“) und allem, was damit einher geht. Vor vielen Jahren konnten Stefan Marquard, Frank Oehler oder andere „Junge Wilde“ noch damit Aufsehen erregen, dass sie wie Motorradrocker aussahen und aus der Küche laute Rockmusik drang. Aber – was hatte das mit der Küche zu tun?
Die „Jungen Wilden“ haben aus heutiger Sicht vielleicht ein paar ungewohnte Kombinationen in die Küche gebracht, waren aber bei weitem nicht so kreativ oder gar revolutionär, wie das gerne publiziert wurde. Zu diesen frühen Zeiten bremste das reine, ganz normale Küchenhandwerk alles wieder aus. Küche ist eben nicht wild und Rock’n’Roll, sondern vor allem pingelige und sorgfältige Arbeit, die auch dann nicht weniger pingelig wird, wenn tätowierte Arme sie herstellen. Heute gibt es längst wesentlich extremere Küchen als Marquard und Co. Aber auch sie unterliegen den ewigen Gesetzen der sorgfältigen Küchenarbeit.
Man will in die Szene. Ab er will das auch die Szene?
Vor einiger Zeit habe ich in Hamburg das „Haco“ besucht. Man macht dort eine sehr moderne, nordisch angehauchte Kreativküche auf hohem Niveau. Das Restaurant liegt in dem Viertel nördlich der Reeperbahn, das im Moment eine Mischung aus Reeperbahn-Seitenstraße, Drogenmilieu, Kreativszene und alternativ-studentischer Szene ist. Das Gebäude ist komplett mit Grafitti verschmiert – also jener Form von Grafitti, die weder künstlerisch noch sonstwie interessant ist, sondern nur alles „markiert“. Nach dem Essen fragte ich den Koch, ob er keine Schwierigkeiten von wegen „Gentrifizierung“ bekommen hätte. Anfangs schon sagte er, aber dann hätte man sich irgendwie daran gewöhnt, dass hier coole Leute arbeiten. An dem Abend, als ich dort war, wurde das Restaurant ausschließlich von Leuten gefüllt, die man immer in solchen Restaurants findet. Von Szene-Publikum gab es jedenfalls keine Spur.
Ich habe – auch von meiner eigenen Biographie her – sehr viel Verständnis dafür, dass man hofft, die gute und vor allem die kreative Küche würde auf Leute treffen, die auch sonst künstlerisch und kreativ sind und vielleicht im gleichen Alter wie die Köche. Aber – das ist mit dem, was heute gemacht wird, nicht oder noch nicht zu realisieren. Fine Dining bleibt so lange ein Luxusereignis, wie die Preise für die Szene jenseits von gut und böse sind. Bizarr ist, dass das ganz normale Gourmetpublikum durchaus nichts dagegen hat, wenn in der Küche wilde Gestalten hausen. Das ganz normale Gourmetpublikum hat auch nichts dagegen, wenn Gourmetrestaurants mitten in Szenevierteln sind. Beides gibt ganz einfach einen kleinen Kick, einen Extra-Schauer, einen Hauch von Authentizität, die tatsächlich ein einziger Selbstbetrug ist. Es gibt da den schönen Satz: „Was muss man tun, um ein neues Restaurant sofort mit den typischen Gourmets 50+ voll zu bekommen?“ Antwort: „Man muss es Szenerestaurant nennen.“
Ich erinnere mich an ein Hamburger-Restaurant in Nürnberg, das offensichtlich immer überfüllt ist. Dort gibt es Hamburger in diversen Formen, und die besten überschreiten preislich die 10 Euro. So etwas geht. 100 Euro oder mehr als „Eintrittspreis“ für ein Restaurant machen es zu einem Vertreter der bürgerlichen Luxuskultur, also für viele aus der Szene zu einem Vertreter dessen, was man nicht will. Daran ist nicht zu rütteln, daran wird sich auch vorerst nichts ändern. Es ist eher ein Wunder, dass noch nicht mehr Gourmetrestaurants in der Nähe von Szenevierteln Probleme bekommen haben. Wer in die Szene will, muss völlig anders denken und arbeiten und völlig andere Preise haben.
Der Weg von den Weißjacken zu tätowierten Bärtigen ist nicht das selbstbewusste Zeichen, als das man es vielleicht gerne interpretiert. Ich wäre mehr dafür, dass man rund um die Kochkunst eine eigene Ästhetik findet, meinetwegen der Szene nahe, aber vielleicht etwas künstlerischer, vielleicht etwas individueller, mit Bilder von Köchen und Restaurants, die nicht irgendwo abgekupfert sind, die nicht demonstrieren sollen, wie man es gerne hätte, sondern die so sind wie sie sind, weil sie dem entsprechen, was die Köche sind. Kobe Desramaults etwa hat sich für eine Mischung aus Chef’s Table und Disco entschieden, laute Musik, herbe Bilder, aber eben hochpreisig. Nobelhart & Schmutzig sind da nicht weit weg – was auch für einige andere gilt. Wer wirklich gute Küche machen will, sollte sich nirgendwo anbiedern.




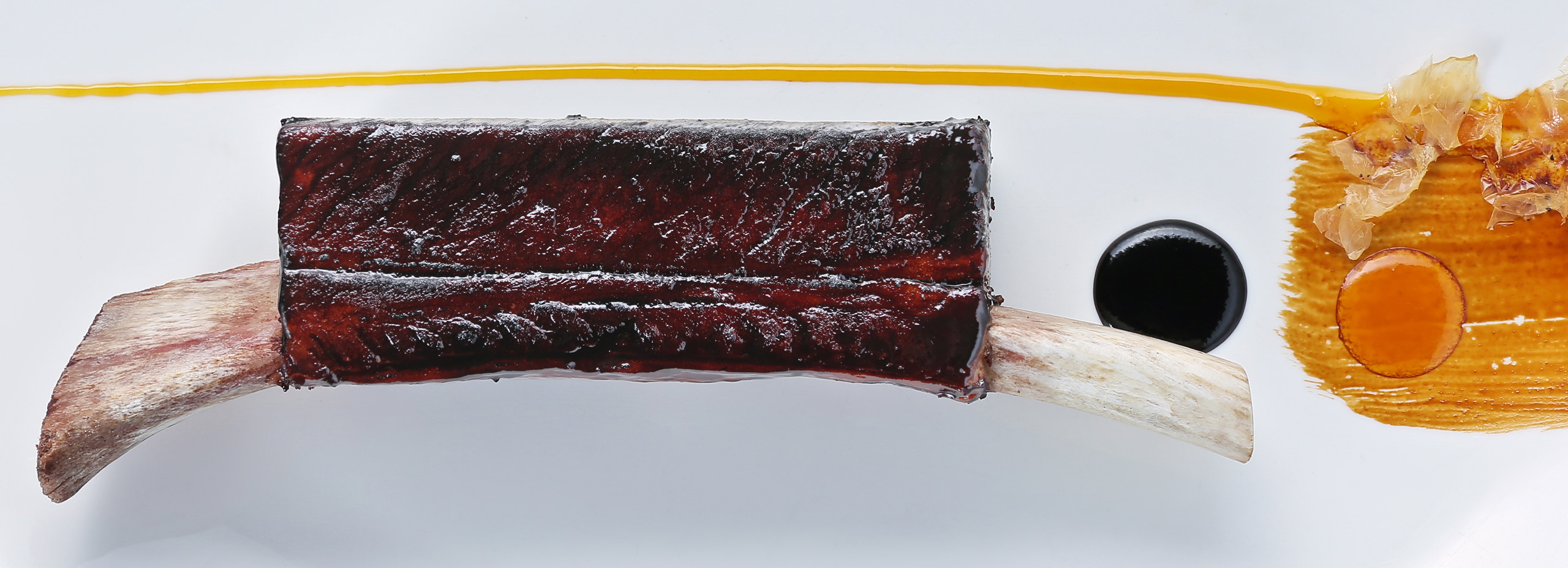


Hamburger Insider sind eher der Ansicht, dass Täter sehr wahrscheinlich aus der Terrororganisation Antifa kämen. Zumal das Jellyfish nicht im Szeneviertel lag.