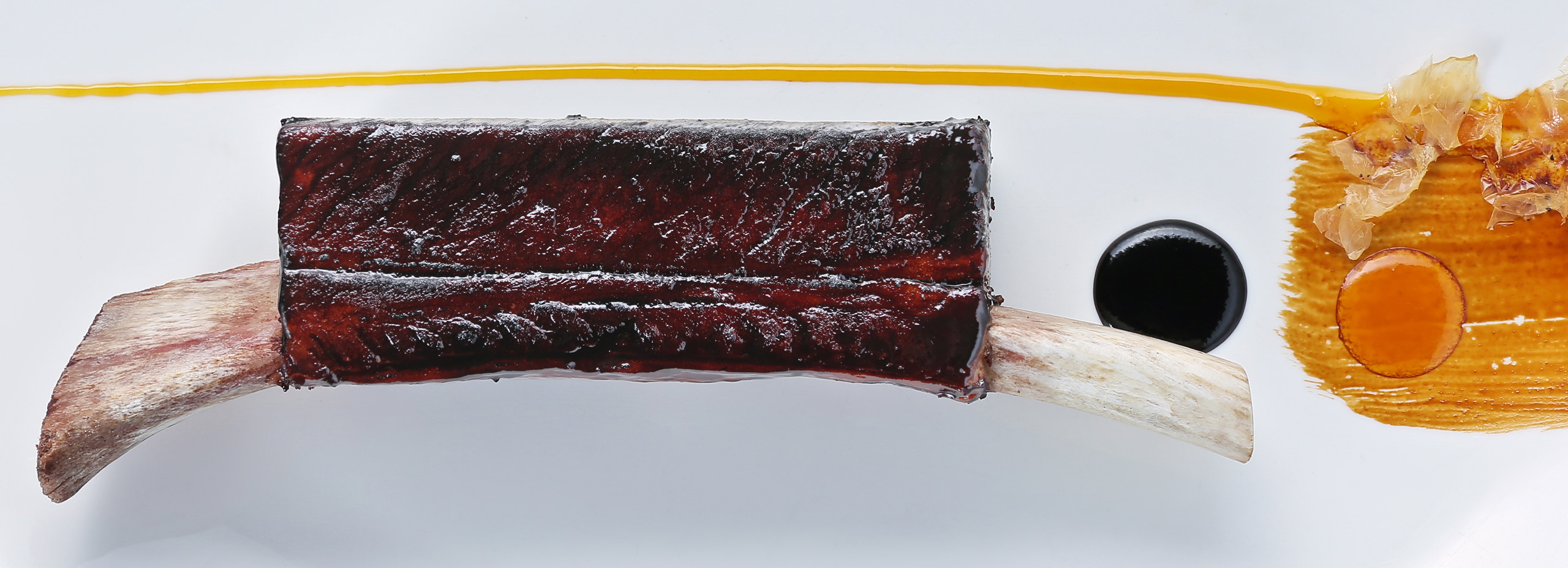Die „Jeunes Restaurateurs Deutschland“ haben kürzlich auf verschiedenen Internetportalen die Ergebnisse ihres 12. Genusslabors veröffentlicht. Der Text hatte die Überschrift: „Reduktion als Trend in der Gastronomie: Wenn aus weniger mehr wird.“ Berichtet wird von verschiedenen praktischen Ansätzen der Mitglieder, aber auch von allerlei Gedanken rund um das Thema. So begrüßenswert solche Treffen und Diskussionen auch sind: man muss beim Lesen den Eindruck gewinnen, als ob das Thema bestenfalls und mehr oder weniger unstrukturiert diskutiert worden ist und noch einer erheblichen Präzisierung bedarf. Es gibt viele unklare Nebenwege – wie zum Beispiel den Verweis auf Aussagen von Daniel Humm auf der „Chef-Sache“, er suche im Prinzip nach Gerichten, die mit zwei Elementen auskommen. Das klingt wie Kartoffel und Butter, ist aber falsch verstanden worden. Daniel Humm ist ein hervorragender Minimalist, der bei seinen Gerichten oft nur sehr wenig Elemente einsetzt. Die aber sind – da hätte man einmal einen Blick in sein letztes Buch werfen sollen – oft sehr komplex zubereitet. Sind sie nun reduziert oder sehen sie nur so aus?
Die „Jeunes Restaurateurs Deutschland“ haben kürzlich auf verschiedenen Internetportalen die Ergebnisse ihres 12. Genusslabors veröffentlicht. Der Text hatte die Überschrift: „Reduktion als Trend in der Gastronomie: Wenn aus weniger mehr wird.“ Berichtet wird von verschiedenen praktischen Ansätzen der Mitglieder, aber auch von allerlei Gedanken rund um das Thema. So begrüßenswert solche Treffen und Diskussionen auch sind: man muss beim Lesen den Eindruck gewinnen, als ob das Thema bestenfalls und mehr oder weniger unstrukturiert diskutiert worden ist und noch einer erheblichen Präzisierung bedarf. Es gibt viele unklare Nebenwege – wie zum Beispiel den Verweis auf Aussagen von Daniel Humm auf der „Chef-Sache“, er suche im Prinzip nach Gerichten, die mit zwei Elementen auskommen. Das klingt wie Kartoffel und Butter, ist aber falsch verstanden worden. Daniel Humm ist ein hervorragender Minimalist, der bei seinen Gerichten oft nur sehr wenig Elemente einsetzt. Die aber sind – da hätte man einmal einen Blick in sein letztes Buch werfen sollen – oft sehr komplex zubereitet. Sind sie nun reduziert oder sehen sie nur so aus?
„Weniger ist mehr“? Wirklich?
Die alten Mißverständnisse rund um weniger oder mehr Elemente auf dem Teller sind offensichtlich nicht aus der Welt zu schaffen. Im Grunde gibt es keinerlei kulinarischen Gründe, die für die eine oder die andere Seite sprechen würden. Ob jemand meint, ein bestimmtes Gericht käme mit wenigen Elementen aus und sei in sich perfekt, ist eine Meinung, nicht aber etwas, das zur Regel gemacht werden könnte. Nehmen wir einen Klassiker: Die Kombination von Seezungenfilets mit Vichy-Karotten und Estragonsauce (Heinz Winkler) lebt von der klaren aromatischen Struktur, bei dem der Estragon die eindeutige Besonderheit ist. Im Zusammenhang mit einer klassischen Sahnesauce und den milden, süßlichen Karotten begleitet dieses Aroma die Seezunge exzellent. Dabei kann man es belassen und bekommt ein Gericht, das bei jedem Bissen mehr oder weniger von dieser Aromatik geprägt ist. Weitere Kontraste und „Ablenkungen“ gibt es nicht. Man könnte das Gericht (das klassischerweise als Spiegel den gesamten Tellerboden bedeckt) so weit reduzieren, dass man ein Stück Seezunge nur knapp mit einem Faden Sauce überzieht, ein oder zwei Karottenscheiben dazulegt und dafür sorgt, dass in der Sauce einige Stücke Estragon zu finden sind.
Man könnte es aber auch als Teil einer Seezungen-Variation auf den Teller bringen, bei der es noch – sagen wir: vier weitere Teile gibt. Ist das nun das Gegenteil von Reduktion, weil viele Elemente auf dem Teller liegen? Auch wenn die anderen Teile der Komposition ebenfalls minimalistisch sind? Bei einer Variation würde man üblicherweise dafür sorgen, dass die Elemente eine andere sensorische Gestalt haben, dass also unterschiedliche Texturen, Aromen, Temperaturen oder auch roh-gekocht-Kontraste vorhanden sind. Wird die Komposition dadurch zu komplex? Für manche Gäste vielleicht unverständlich?
Damit ist keineswegs zu rechnen. Wie aber sieht es aus, wenn es sich nicht um eine Variation von quasi einzelnen, reduzierten Gerichten handelt, sondern sich die sensorischen Parameter rund um ein Hauptprodukt entwickeln und auf es bezogen sind? Ist die Vielfalt dann plötzlich falsch? Auch wenn sich – wie das häufig der Fall ist – das Hauptprodukt an verschiedenen Stellen des Gerichtes wiederholt?
Nein, Reduktion und Vielfalt sind keine kulinarischen Gegensätze, sondern unterschiedliche Möglichkeiten.
Beide Seiten eignen sich nicht, um daraus einen Trend oder sonst eine Entwicklung abzuleiten, die letztlich nur zu einer Verarmung der Kochkunst führt. Jede Begrenzung der gestalterischen Möglichkeiten durch einen angeblichen „Trend“ läuft Gefahr, an irgendeiner Stelle Substanz zu verlieren.
Was es sehr wohl gibt, sind gastronomische Gründe, die aber oft im Gegensatz zu kulinarischen Optimierungen aller Art stehen.
In dem Moment, wo man sich vorwiegend um die Verkäuflichkeit von Gerichten kümmert, werden eine ganze Menge von Überlegungen wichtig, die aber im Grunde vor allem mit einem Problem zu tun haben, nämlich der Qualität der kulinarischen Wahrnehmung bei den Gästen. Deren mögliche Defizite zum Ausgangspunkt der eigenen Planungen zu machen, ist das typische Geschäft ausschließlich kommerzieller Anbieter also etwa der Fast Food-Ketten. Alle anderen, die nicht nur verkaufen, sondern auch etwas Gutes produzieren wollen, sollten sich diese Mechanismen immer vor Augen halten. Reduktion? Vielleicht. Aber dann auf einem so hohen Niveau, dass es wirklich jeder Gast merkt. Ansonsten droht ein Mittelmaß, das im Laufe der Zeit eine nach unten gerichtete Qualitätsspirale in Gang setzt.
Was „Reduktion“ wirklich bedeutet, hat bisher kaum ein Koch realisiert
Vielen Köchen fehlt schon wegen ihrer Ausbildung ein Blick auf das, was wirklich alles zu reduzieren wäre, wenn man es mit Produktnähe und Minimalismus ernst meinen würde. Wer wirklich „Reduktion auf das Wesentliche“ will, sollte auch nennen können, was denn das Wesentliche überhaupt ist. Dabei ergeben sich eine ganze Reihe von Fragen wie etwa die, ob die Dauerberieselung aller und jeder Elemente eines Gerichtes mit Salz und Pfeffer nicht gegen den Produktgeschmack geht, ob die Verwendung von Fonds nicht eine ähnlich nivellierende Wirkung hat oder die ständige Anwesenheit von Zwiebeln in Saucenansätzen klassischer Art vielleicht ein bestimmtes Geschmacksbild erzeugt, nicht aber zwingend notwendig ist. Den alten Automatismen aus der traditionellen Kochausbildung sind längst neue Atomatismen (zur zeit vor allem aus dem asiatischen Bereich) gefolgt – in beiden Fällen geht es um die selbstverständliche Verkleisterung von Produktaromen durch alterprobte „Mittelchen“.
Eine radikale Bestimmung des Wesentlichen und eine wirkliche Reduktion auf grundlegende Parameter der Kochkunst ist nach wie vor nur in einer sehr kleinen Anzahl von Restaurants zu erleben. Und – es ist auch nicht so, dass eine solche reduzierte Küche automatisch etwas „für den Gast“ wäre. Auf klare, unverfälschte Produktaromen mit minimalistischen Zutaten „zurückgesetzt“, reagieren viele Gäste so, wie sie reagieren können, nämlich mit einer Ablehnung eines Geschmacksbildes, das sie aufgrund ihrer kulinarischen Sozialisation nicht kennen. Ich habe diese Probleme in meinen Büchern übrigens längst ausführlich diskutiert. In „Pur, präzise, sinnlich“ finden sich dazu auch viele Beispielrezepte.
Die Fragen rund um „Reduktion“ und „Konzentration auf das Wesentliche“ sind und bleiben aber sehr interessant. Eine so oberflächliche Diskussion, wie offensichtlich die bei den Jeunes Restaurateurs geführte, kann aber sehr schnell zu einem klassischen Eigentor werden.